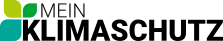GEG: Das Gebäudeenergiegesetz im Detail
Wer ein Haus baut oder saniert, muss seit November 2020 das Gebäudeenergiegesetz (GEG) beachten. Die Novellierung(en) des Gesetzes sorgten für Verunsicherung bei Immobilienbesitzer*innen. Seit 2024 gelten die neuen Regelungen. Wir klären die wichtigsten Fakten im Videoüberblick und informieren im Artikel ausführlich über Heizen mit erneuerbaren Energien sowie Kosten und Förderung – inklusive Erfahrungsberichte zu Wärmepumpe, Photovoltaik und Co.
Sanierungskosten einschätzen mit dem ModernisierungsCheck
Mit dem Modernisierungskosten-Rechner können Sie prüfen, welche Sanierungsmaßnahmen sich für Ihr Gebäude lohnen und wie viel Energie Sie dadurch sparen.
Die wichtigsten Fakten auf einen Blick
- Gebäudeenergiegesetz regelt energetische Anforderungen an Gebäude
- GEG-Novellierung sieht Umstieg auf erneuerbare Energien vor
- Gebäude dürfen nur einen bestimmten Primärenergiebedarf haben
- Umfrage zeigt große Akzeptanz für die Wärmewende
- Kompakter Überblick zum GEG im Video "Heizungsgesetz verabschiedet – Was jetzt?"
- Erfahrungsberichte zeigen, was in der Praxis möglich ist mit Wärmepumpe, Photovoltaik und Co.
Was ist das Gebäudeenergiegesetz?

Ziel der Bundesregierung ist es, durch das Gebäudeenergiegesetz die wichtigen Gesetze zum Energiesparen in Gebäuden zu vereinen.
Das Gebäudeenergiegesetz, kurz GEG, regelt die Anforderungen an die energetische Qualität von beheizten oder klimatisierten Gebäuden. Seine Vorgaben beziehen sich unter anderem auf die Heiztechnik und den Einsatz von erneuerbaren Energien. Konkret sieht das Gesetz vor, dass nur Gebäude mit einer guten Gesamteffizienz errichtet werden dürfen, damit der Energie-verbrauch und die CO2-Emissionen im Gebäudesektor langfristig sinken.
Seit dem ersten Inkrafttreten im Jahr 2020 wurde das GEG bis 2024 mehrmals novelliert und überarbeitet. Unter anderem die mediale Berichterstattung dazu führte zu einer großen Verunsicherung unter Verbraucher*innen: ab wann gelten welche Vorgaben unter welchen Bedingungen mit welchen Auswikrungen?
Für einen kurzen Überblick hat unser Pressesprecher Alexander Steinfeldt alles wichtige zum GEG in diesem Video für Sie zusammengefasst. Über alle Details können Sie sich im anschließenden Artikel informieren.
Gebäudeenergiegesetz seit November 2020 gültig
Das GEG trat zum 1. November 2020 in Kraft und führte mehrere alte Gesetze und Verordnungen zusammen, darunter: Energieeinsparverordnung (EnEV), Energieeinsparungsgesetz (EnEG) und Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG). Die Bundesregierung erfüllte damit die Vorgaben der EU-Gebäuderichtlinie, im GEG eine Regelung für Niedrigstenergiegebäude festzulegen.
Gebäudeenergiegesetz 2020, 2022 und 2023
Obwohl es erst 2020 in Kraft getreten ist, gab und gibt es immer wieder Kritik und Änderungswünsche in Richtung Gesetzgeber. Kritiker*innen forderten unter anderem, den zulässigen Jahresprimärenergiebedarf für Neubauten von 75 auf 55 Prozent – im Vergleich zu einem Referenzgebäude – zu senken. Diese und weitere kleinere Änderungen wurden am 28. Juli 2022 übernommen und im Bundesgesetzblatt verkündet. Sie sind zum Jahresanfang 2023 in Kraft getreten.
GEG und Heizen – was die Novellierung bedeutet
Nach der „kleinen“ Novellierung im Sommer 2022 folgte die „große“ im Jahr 2023. Diese war bereits im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung vorgesehen und bekam durch die Energiekrise noch mehr Brisanz. Der Hauptstreitpunkt war dabei das Thema „Umstieg auf erneuerbare Energien beim Heizen“. Dabei kam es durch die mediale Berichterstattung zu einer großen Verunsicherung seitens der Verbraucher*innen: Falsche Aussagen vermischten sich mit Fakten. Begriffe wie „Heizungsverbot“ oder „Heizhammer“ emotionalisierten das Thema stark.

Was die GEG-Novellierung im Bereich Heizen konkret bedeutet
Seit 2024 müssen Eigentümer*innen beim Einbau neuer Heizungen konsequent auf erneuerbare Energie setzen. Das heißt konkret, dass möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Eine Technologie, die sich hierfür sehr gut eignet, ist die Wärmepumpe. Sie ist aber nicht die einzige Heizoption, die Eigentümer*innen haben.
NEU: Informationspflicht bei Einbau einer fossilen Heizung
Außerdem wurde eine Beratungs- und Informationspflicht beim Einbau einer Öl- oder Gasheizung beschlossen. Das bedeutet konkret: Bevor eine neue Heizungsanlage auf Basis eines festen, flüssigen oder gasförmigen Brennstoffs eingebaut wird, muss eine Beratung durch eine entsprechende Fachkraft erfolgen. Dies kann etwa ein/e Schornsteinfeger*in, Heizungsbauer*in oder Energieberater*in sein.
In dem Gespräch muss vor allem auf die möglichen Kostenrisiken durch steigende CO2- und Brennstoffpreise sowie auf die möglichen Auswirkungen der örtlichen Wärmeversorgung hingewiesen werden.
GEG-Heizoptionen bei Neubau und Altbau
Die 65-Prozent-Regel können Eigentümer*innen auch dann einhalten, wenn sie ihre Heizanlage an ein Wärmenetz (Fern- oder Nahwärme) anschließen, eine Stromdirektheizung wie die Infrarotheizung installieren oder eine Hybridheizung einbauen lassen. Auch die Nutzung einer Gasheizung ist möglich, sofern sie nachweislich mit erneuerbaren Gasen betrieben wird. Wer in einem Bestandsgebäude wohnt, darf auch auf eine Holzheizung (z. B. Pelletkessel) zurückgreifen. Nach den aktuellen Leitplanken gilt das auch für Neubauten.
Heizoptionen laut Novellierung im Überblick
- Anschluss an ein Wärmenetz (Fern- oder Nahwärme)
- Einbau einer elektrischen Wärmepumpe
- Stromdirektheizung
- Einbau einer Gasheizung, die nachweislich erneuerbare Gase nutzt
- Einbau einer Hybridheizung
- Einbau einer Biomasseheizung (Holzheizung, Pelletheizung, Holzhackschnitzelheizung etc.)
GEG: Förderung für Heizung wird neugestaltet
Mit dem neuen GEG sind seit dem 1. Januar 2024 auch die neuen Förderbedingungen für den Heizungstausch in der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) in Kraft.
- Es wird eine Basisförderung von 30 Prozent geben für alle, die alte fossile Heizsysteme austauschen – egal ob Hauseigentümer*innen, Vermietende, Unternehmen, gemeinnützige Vereine oder Kommunen.
- Zusätzlich wird es für Eigentümer*innen, die ihr Haus selbst bewohnen und deren zu versteuerndes Einkommen unter 40.000 Euro liegt, einen Einkommensbonus von 30 Prozent geben.
- Und einen Geschwindigkeitsbonus von 20 Prozent bekommen die, die ihre alte Gasheizung oder Ölheizung bis 2028 austauschen und ihr Haus selbst bewohnen. Danach sinkt der Geschwindigkeitsbonus alle zwei Jahre um 3 Prozentpunkte.
- Der Innovationsbonus von 5 Prozent für Luft-Wärmepumpen mit natürlichem Kältemittel und Erd-Wärmepumpen wird bestehen bleiben.
- Dämmmaßnahmen werden weiterhin mit 15 bis 20 Prozent gefördert.
Maximal wird eine Förderung von 70 Prozent auf maximal 30.000 Euro Investitionskosten gewährt.
Kosten für eine neue Heizung sollen zu 10 Prozent auf die Mieter*innen umgelegt werden können – maximal darf die Miete um zusätzlich 50 Cent je Quadratmeter Wohnfläche steigen. Härtefälle müssen aber berücksichtigt werden. Für Mieter*innen, deren Miete durch die Modernisierung auf mehr als 30 Prozent ihres Haushaltseinkommens ansteigt, soll nur eine beschränkte Umlagefähigkeit gelten. Zudem sollen Mieterhöhungen bei Indexmieten ausgeschlossen sein.
Das GEG und die Kosten bei Hausbau und Sanierung
Um den Energieverbrauch im Gebäudesektor langfristig zu senken, müssen nicht nur effizientere Heiztechniken verbaut werden. Viel dringender ist es, die betreffenden Objekte energetisch zu sanieren. Im Optimalfall passieren beide Maßnahmen nacheinander und in der richtigen Reihenfolge (erst sanieren, dann neue Heiztechniken). Dann kommen auch die Vorteile der Gebäudesanierung am stärksten zum Tragen.
Wie hoch die Kosten dabei ausfallen, lässt sich nur individuell ermitteln, zum Beispiel mit dem ModernisierungsCheck. Zur Orientierung finden Sie weiter unten außerdem eine Beispielrechnung für ein fiktives Referenzgebäude:
Vorteile von sanierten Gebäuden
Sanierungskosten: Beispielrechnung anhand eines Referenzgebäudes
Die Tabelle zeigt eine Beispielrechnung von Sanierungskosten für folgendes Referenzgebäude:
- Durchschnittliches Einfamilienhaus
- Baujahr 1970
- Wohnfläche: 110 m2
- Dämmung: zuletzt 1993
- Heizung: Gasheizung
Ermittelt wurden Sparpotenziale, Kosten (inkl. Förderungen) für die Komplettsanierung (Dämmung der Gebäudehülle, Heizungstausch und Solarenergie-Anlage) und CO2-Emissionen.
| Luftwärme-pumpen | Erdwärme-pumpen | Pellet-heizung | Fern-wärme | |
|---|---|---|---|---|
| Heizenergie- verbrauch aktuell (kWh/m²) | 148 | |||
| Heizenergie-verbrauch nach Modernisierung (kWh/m²) | 49 | 45 | 94 | 87 |
| Investitionskosten (Vollsanierung inklusive) in € | 79.900 | 81.330 | 83.670 | 78.280 |
| monatliche Kreditrate inkl. Förderung in € (Laufzeit 20 Jahre) | 377 | 383 | 393 | 323 |
| monatlich eingesparte Energiekosten* in € | 403 | 423 | 537 | 507 |
| CO2-Emissionen aktuell (t CO2/Jahr) | 4,9 | |||
| CO2-Emissionen nach der Modernisierung (t CO2/Jahr) | 0 | 0 | 0,3 | 3,0 |
*Die Prognose zur Energieeinsparung bezieht sich auf die Heizenergie und betrachtet den mittleren Energiepreis über 20 Jahre (bei Gas z.B. mit einer durchschnittlichen Steigerung von 2,6 % pro Jahr).
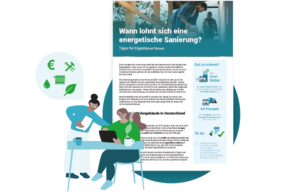
Sie möchten weitere Rechenbeispiele und Tipps?
Finden Sie beides in unserer Sanierungshilfe!
Umfrage: Weitgehend Zustimmung für geplante Gesetzesvorhaben
Auch wenn der Umstieg auf erneuerbare Energien für viele Menschen eine finanzielle Herausforderung darstellt: In den Umfragen von co2online überwiegt die Akzeptanz für die geplanten Änderungen. So hat fast die Hälfte der Befragten angegeben, dass sie ein entsprechendes Klimaschutzgesetz unterstützen würde.
Als Bedingung für ihre Zustimmung haben die Befragten in erster Linie die individuelle Finanzierbarkeit des Vorhabens genannt. Dicht dahinter stehen die sichere Verfügbarkeit von Handwerker*innen sowie eine transparente Aufschlüsselung von möglichen Folgen.
Die zwei Umfragen wurden zwischen Februar und März 2023 mit jeweils mehr als 5.000 Teilnehmenden durchgeführt. Die aufbereiteten Ergebnisse sind im Trendreport Wärmewende in Deutschland abgebildet.
Das Gebäudeenergiegesetz und seine konkreten Anforderungen
Bis die GEG-Novellierung im Bundestag verabschiedet ist und am 1. Januar 2024 in Kraft tritt, gelten die derzeit bestehenden Anforderungen weiterhin.
GEG und Neubau: Hohe Anforderungen an Energieeffizienz
Das GEG verlangt von Neubauten eine bessere Energieeffizienz durch die Vorgabe
- eines maximal zulässigen Primärenergiebedarfs sowie
- eines Höchstwertes für den Wärmedurchgangskoeffizienten der Gebäudehülle.
Die folgende Tabelle zeigt einen Ausschnitt aus dem Gesetz (S. 40 ff.).
Technische Ausführung des Referenzgebäudes (Wohngebäude)
| Bauteile | U-Wert (Wärme-durchgangs-koeffizient) |
|---|---|
| Außenwand (einschließlich Einbauten, wie Rollladenkästen), Geschossdecke gegen Außenluft | 0,28 W/(m2K) |
| Außenwand gegen Erdreich, Boden- platte, Wände und Decken zu unbe- heizten Räumen | 0,35 W/(m2K) |
| Dach, oberste Geschossdecke, Wände zu Abseiten | 0,20 W/(m2K) |
| Fenster, Fenstertüren | 1,3 W/(m2K) |
Zudem müssen Neubauten einen bestimmten Anteil an erneuerbaren Energien aufweisen, beispielsweise durch den Einsatz von Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen.
| Energieträger | Verpflichtender Anteil |
|---|---|
| Solarthermie | 15 % |
| eigener Ökostrom1 | 15 % |
| Wärmepumpe | 50 % |
| Holzpelletkessel2 | 50 % |
| Pflanzenöl3 | 50 % |
| Biomethan4 | 30/50 % |
| KWK | 50 % |
| Brennstoffzelle | 40 % |
- 1: gebäudenah erzeugter und vorrangig selbst verbrauchter Ökostrom; mit eigener Photovoltaik-Anlage erfüllt, wenn: kWp PV ≥ Gebäudenutzfläche x 0,03 / Anzahl der beheizten Geschosse
- 2: feste Biomasse
- 3: flüssige Biomasse
- 4: gasförmige Biomasse, 30 Prozent: KWK-Anlage, 50 Prozent: Brennwertkessel
GEG und Bestandsgebäude: Austauschpflicht für alte Heizungen
Es besteht weiterhin eine Austauschpflicht für Ölheizungen und Gasheizungen, die älter als 30 Jahre sind. Ausnahmen gelten wie gehabt für Brennwertkessel und Niedertemperaturkessel. Bei selbst genutzten Ein- und Zweifamilienhäusern greift die Austauschpflicht laut § 73 erst nach einem Wechsel der Eigentümer*innen.
Das GEG verpflichtet Eigentümer*innen von Altbauten zudem dazu, im Rahmen von Sanierungen bestimmte energetische Mindeststandards einzuhalten. So müssen beispielsweise bei umfassenden Sanierungen der Wärmeschutz der Gebäudehülle und der Energieverbrauch der Heizungsanlage verbessert werden. Auch hier sind im Gebäudeenergiegesetz detailliierte Angaben zu finden, wie der folgende Ausschnitt zeigt:
Tabelle: Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten bei Änderung an bestehenden Gebäuden
| Bauteile | U-Wert bei Modernisierung |
|---|---|
| Außenwände | 0,24 W/(m2K) |
| Gegen Außenluft abgrenzende Fenster und Fenstertüren | 1,3 W/(m2K) |
| Gegen Außenluft abgrenzende Dachflächenfenster | 1,4 W/(m2K) |
Gegen Außenluft abgrenzende Dachflächen einschließlich Dachgauben | 0,24 W/(m2K) |
GEG für Neubau und Altbau: Energieausweise und Pflicht zur Beratung
Der Energieausweis ist eine Übersicht für Bauherr*innen, Käufer*innen und Mieter*innen über den zu erwartenden Energieverbrauch des Gebäudes. Durch das Gebäudeenergiegesetz müssen Energiebedarfsausweise nun zusätzlich auch die CO2-Emissionen nennen, die sich aus dem Endenergiebedarf für Heizung und Kühlung ergeben. Bei Verkauf oder Vermietung muss der/die Eigentümer*in die Ausstellung eines Energieausweises veranlassen. Spätestens bei der Besichtigung muss den potenziellen Käufer*innen oder Mieter*innen der Energieausweis vorgelegt werden. Auch bei Neubau oder einer Sanierung mit Neubewertung des Gebäudes muss ein Energieausweis ausgestellt werden.
Seit 2020 gilt zudem eine verpflichtende Energieberatung beim Kauf von Ein- oder Zweifamilienhäusern und für Eigentümer*innen bei Sanierungen. Die Pflicht besteht allerdings nur, wenn das Gespräch kostenlos ist. Die Beratungsgespräche müssen mit einer Person erfolgen, die zum Ausstellen von Energieausweisen berechtigt ist. Kostenlose Gespräche bieten in erster Linie die Verbraucherzentralen an, in unserer Datenbank finden Sie außerdem Energieberater*innen in Ihrer Nähe.
Das vollständige Gebäudeenergiegesetz können Sie hier einsehen.
Erfahrungsberichte: Gesichter der Energiewende
FAQ – Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen
-
Was ist das GEG?
Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Bundesgesetz und legt fest, welche energetischen Standards ein neues oder saniertes Gebäude mindestens erreichen muss. Es regelt auch Pflichten und Vorgaben zur Beheizung von Gebäuden, zum Beispiel das Verbot von Ölheizungen.
-
Für welche Gebäude gilt das GEG?
Das GEG gilt seit 1. November 2020 für alle Gebäude, die beheizt oder klimatisiert werden. Seine Vorgaben beziehen sich vorwiegend auf die Heizungstechnik und den Wärmedämmstandard des Gebäudes. Eine Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes wurde am 8. September 2023 im Deutschen Bundestag beschlossen. Sie ist am 1. Januar 2024 in Kraft getreten.
-
Welche Regeln zum Heizen gibt es?
Ein Anteil von 65 Prozent erneuerbarer Energien soll beim Einbau einer neuen Heizung möglichst erreicht werden. Im novellierten GEG wird beschrieben, wie dies ermöglicht werden kann. Für Neubauten gilt diese Regelung seit 2024. Für Bestandsgebäude gibt es noch Übergangsfristen, die von der Wärmeplanung vor Ort abhängig sind. Konkret gilt die 65-Prozent-Regel im Altbau ab dem Zeitpunkt, an dem eine kommunale Wärmeplanung vorliegt. Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohner*innen müssen ihren Bürger*innen bis spätestens Mitte 2026 mitteilen, ob und wo Wärmenetze geplant sind. Kleinere Städte und Landkreise haben bis Mitte 2028 Zeit.
-
Was genau trat am 1. Januar 2024 in Kraft?
Zum 1.1.2024 trat das novellierte Gebäudeenergiesetz in Kraft. Darauf hatten sich die Ampelparteien am 8.9.2023 geeinigt.
-
Was ist mit Gebäuden außerhalb von Neubaugebieten?
Liegt in der betreffenden Ortschaft eine kommunale Wärmeplanung vor, die ein klimaneutrales Netz vorsieht
- dürfen Gasheizungen weiterhin eingebaut werden, sofern sie auf Wasserstoff umrüstbar sind.
Liegt in der betreffenden Ortschaft eine kommunale Wärmeplanung vor, die kein klimaneutrales Netz vorsieht
- dürfen nur Gasheizungen eingebaut werden, die zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden.
Liegt in der betreffenden Ortschaft keine kommunale Wärmeplanung vor
- dürfen ab dem 1.1.2024 Gasheizungen auch in Neubauten außerhalb von Neubaugebieten eingebaut werden.
-
Wie ist der aktuelle Stand bei den kommunalen Wärmeplänen?
Einige Bundesländer wie Baden-Württemberg, Schleswig-Holzstein und Niedersachsen verpflichten ihre Kommunen bereits dazu, entsprechende Wärmepläne aufzustellen. Eine flächendeckende bundesweite Wärmeplanung wird bis spätestens 2028 angestrebt.
-
Wie ist die geplante Heizungsförderung?
Mit dem neuen GEG sind seit dem 1. Januar 2024 auch die neuen Förderbedingungen für den Heizungstausch in der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) in Kraft.
- Es wird eine Basisförderung von 30 Prozent geben für alle, die alte fossile Heizsysteme austauschen – egal ob Hauseigentümer*innen, Vermietende, Unternehmen, gemeinnützige Vereine oder Kommunen.
- Zusätzlich wird es für Eigentümer*innen, die ihr Haus selbst bewohnen und deren zu versteuerndes Einkommen unter 40.000 Euro liegt, einen Einkommensbonus von 30 Prozent geben.
- Und einen Geschwindigkeitsbonus von 20 Prozent bekommen die, die ihre alte Gasheizung oder Ölheizung bis 2028 austauschen und ihr Haus selbst bewohnen. Danach sinkt der Geschwindigkeitsbonus alle zwei Jahre um 3 Prozentpunkte.
- Der Innovationsbonus von 5 Prozent für Luft-Wärmepumpen mit natürlichem Kältemittel und Erd-Wärmepumpen wird bestehen bleiben.
Maximal wird eine Förderung von 70 Prozent auf maximal 30.000 Euro Investitionskosten gewährt.
Dämmmaßnahmen werden weiterhin mit 15 bis 20 Prozent gefördert.
Kosten für eine neue Heizung sollen zu 10 Prozent auf die Mieter*innen umgelegt werden können – maximal darf die Miete um zusätzlich 50 Cent je Quadratmeter Wohnfläche steigen. Härtefälle müssen aber berücksichtigt werden. Für Mieter*innen, deren Miete durch die Modernisierung auf mehr als 30 Prozent ihres Haushaltseinkommens ansteigt, soll nur eine beschränkte Umlagefähigkeit gelten. Zudem sollen Mieterhöhungen bei Indexmieten ausgeschlossen sein.
-
Gibt es Übergangslösungen und -fristen?
Bei einem Totalausfall der Gas- oder Ölheizung erhalten Eigentürmer*innen eine Übergangszeit von fünf Jahren. Bei Mehrfamilienhäusern mit Gasetagenheizungen beträgt die Übergangszeit bis zu 13 Jahre. Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem erstmals Arbeiten zum Kesseltausch durchgeführt werden.
-
Muss es immer die Wärmepumpe sein?
Nein, Eigentümer*innen können unterschiedliche Optionen wählen, um die Pflicht zum Anteil erneuerbarer Energien zu erfüllen. Beim Neubau und bei Bestandsgebäuden kann man zwischen den folgenden Möglichkeiten wählen:
- Anschluss an ein Wärmenetz
- Einbau einer elektrischen Wärmepumpe
- Stromdirektheizung
- Einbau einer Gasheizung, die nachweislich erneuerbare Gase nutzt
- Einbau einer Hybridheizung
- Einbau einer Biomasseheizung (Holzheizung, Pelletheizung etc.)
-
Wie soll ich nachweisen, dass ich mit erneuerbaren Energien heize?
Die Umsetzung der Regelung zum klimafreundlichen Heizen mit erneuerbaren Energien soll in der Praxis einfach und unbürokratisch ausgestaltet werden.
So soll es für die Prüfung durch Schornsteinfeger*innen in vielen Fällen keinen rechnerischen Nachweis benötigen, dass die „Erneuerbaren-Vorgabe“ in der Praxis eingehalten wird. Stattdessen soll es vorab eine definierte Reihe von Möglichkeiten zur Umsetzung geben. Wählt man eine davon aus, gilt die Vorgabe als erfüllt (sogenannte Vermutungsregelung).
-
Was sind Mindesteffizienzstandards für Gebäude?
Für Bestandsgebäude sollen energetische Mindesteffizienzstandards (MEPS) festgelegt werden. Diese werden derzeit in den europäischen Institutionen erarbeitet und müssen dann von den EU-Mitgliedstaaten ins jeweilige nationale Recht umgesetzt werden. In Deutschland wird dafür voraussichtlich das Gebäudeenergiegesetz erneut angepasst. Der Vorschlag des Europäischen Parlaments sieht eine Einteilung der Gebäude in sieben Effizienzklassen vor: von Klasse A für Niedrigemissionsgebäude bis Klasse G für die ineffizientesten 15 Prozent des jeweiligen nationalen Gebäudebestands. Gebäude der Klassen F und G sollten bis zum Jahr 2030, Gebäude der Klasse E bis 2033 saniert werden. Aufgrund der anhaltenden Beratungen sind die genauen Anforderungen noch nicht klar.
-
Wie ist der aktuelle Stand in Deutschland?
Laut einer Auswertung unserer Gebäudedatenbank mit über eine Million Gebäudedaten aus ganz Deutschland könnten folgende Verbrauchswerte die Einteilung in die Gebäudeklassen bestimmen:
Gebäudeklasse jährlicher Heizenergieverbrauch pro Quadratmeter Anzahl der Gebäude A bis 65 kWh 2,3 Mio. B von 66 bis 90 kWh 3,1 Mio. C von 91 bis 110 kWh 3,3 Mio. D von 111 bis 130 kWh 3,1 Mio. E von 131 bis 150 kWh 2,5 Mio. F von 151 bis 175 kWh 2,1 Mio. G ab 176 kWh 2,8 Mio. Gebäude mit einem Heizenergieverbrauch ab 151 kWh pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr, insgesamt 4,9 Millionen Gebäude, müssten danach bis 2030 saniert werden. Das entspräche größtenteils allen unsanierten, teilsanierten oder vor 1984 sanierten Gebäuden. Die 7,4 Millionen Gebäude mit einem Verbrauch ab 131 kWh müssten bis 2033 saniert werden. Das würde zusätzlich vor 1995 sanierte Gebäude betreffen. Im Jahr 2021 lag der durchschnittliche Heizenergieverbrauch bei 121,5 kWh pro Quadratmeter.